Seit neun Monaten lässt Trump Russland in der Ukraine gewähren. Trotzdem behaupten Medien wegen einem Wort, er gehe hart gegen Putin vor. Unverantwortlich.
Als Donald Trump am Wochenende aus dem Weißen Haus in Washington geht, beweist der US-Präsident entweder magische Fähigkeiten oder das deutsche Nachrichtenfernsehen Welt beweist desaströsen Journalismus.
Ein Journalist fragt, ob Trump inzwischen bereit sei, härtere Sanktionen gegen Russland zu verhängen. „Jepp“, antwortet dieser. Dann geht er weiter.
„Schluss mit lustig!“, titelt Welt daraufhin. „Trump bereit für weitere Sanktionen gegen Russland!“ Die Überschrift verspricht „Top News“. In einem anderen, längeren Video ordnet ein Experte die Bedeutung möglicher Sanktionen ein. „USA: Trump will Putin mit neuen Sanktionen hart treffen!“, überschreibt Welt dieses Video. „Diese Ankündigung lässt Europäer aufhorchen.“
Sensation, Sensation, Sensation.
Den wichtigsten Punkt spricht Welt nicht an.
Medien schmücken Trumps Ankündigung aus
Hintergrund der Frage des Journalisten ist, dass Trump Russlands Präsidenten Wladimir Putin schon vor Langem mit einer „Stufe 2“ und „Stufe 3“ der Sanktionen drohte. Bislang ließ er keine Taten folgen. Stattdessen hofierte er Putin beim Gipfel in Alaska und übernahm eher wieder dessen Erzählungen. Der Journalist wollte wissen, ob Trump angesichts enorm harter Angriffe Russlands auf die Ukraine nun endlich die angekündigte „Stufe 2“ einleite.
Den bedeutungslosen Laut, mit dem Trump diese Frage beantwortet, verwandelt die Welt in eine Eilmeldung. Die Nachrichtenagentur Reuters tut das Gleiche, die britische BBC und viele weitere Medien ebenfalls.
Dabei verkündet Trump mit seinem „Jepp“ nichts. Er sagt nicht, was die angedrohten Phasen zwei und drei bedeuten sollen. Er sagt nicht einmal, ob er von den massiven Angriffen Russlands auf die Ukraine weiß. Und erst recht nicht, warum er plötzlich hart gegen Putin vorgehen will, wenn er das bislang nicht konnte oder wollte.
Trump beantwortet eine Frage, die er kaum mit „Nein“ beantworten kann, mit einem kurzen „Jepp“ und geht weiter.
Ernstzunehmenden Politikern würden wir nach einer Antwort wie dieser unterstellen, nichts zum Thema zu wissen: „Schnell etwas sagen und weg.“ Bei Trump betten Welt und andere Medien das Wort in einen Zusammenhang, den es nicht gibt. „Ankündigung“, „Trump will Putin mit neuen Sanktionen hart treffen!“ – nichts davon lässt sich aus einem „Jepp“ ableiten.
Wer anderes berichtet, biegt die Wahrheit. Mindestens.
Sanewashing verzerrt die Realität
Im Internet verbreitet sich für diese Art der Berichterstattung der Begriff „Sanewashing“. Frei übersetzt heißt das „Normalschminken“: Wir tun, als wäre Trump ein normaler Politiker, dessen Aussagen wir ernst nehmen können. Können wir aber nicht.
Bei deutschen Populisten begehen wir den gleichen Fehler. Die AfD und Sahra Wagenknecht verwenden ähnliche Techniken wie Trump. Sie fluten das Land mit Verschwörungstheorien und ständig wechselnden Meinungen, hinter denen sie Bestechungen und fehlende echte Antworten verbergen. Trotzdem diskutieren wir lieber den nächsten Auswurf als zu erinnern, warum sie diese Parolen verbreiten und das hinter ihnen keine Taten stehen.
Wir erzeugen falsche Erwartungen. Wir verzerren die Realität. Wir helfen, Politiker wie Trump, AfD und Wagenknecht zu normalisieren. Das ist gefährlich.
Trump droht Putin immer wieder mal. Umgesetzt hat er seine Drohungen bislang nie. Nichts deutet darauf hin, dass er es jetzt tut. Das gehört zur Wahrheit. Hier ein Beispiel von vor dem Treffen in Alaska.
Warum Trump anders ist
Trump ist kein Obama, kein Bush, kein normaler Politiker. Er ist ein „post-truth“-Populist. Seine Aussagen widersprechen sich regelmäßig. Oft sagt er innerhalb einer Rede oder Pressekonferenz widersprüchliche Dinge.
Wer Trump behandelt, als ließe sich aus einem „Jepp“ eine klare Linie ableiten, begeht einen Fehler. Friedrich Merz (CDU) oder Lars Klingbeil (SPD) könnten wir später selbst auf ein „Jepp“ festnageln. Sie fühlen sich an Aussagen gebunden. Populisten nicht. Wollen Medien ihre Leser oder Zuschauer ehrlich informieren, müssen sie das erwähnen. Sonst gefährden sie unsere Demokratie.

Auch das verkündete Trump am Wochenende in den Sozialen Medien: Der US-Präsident erklärte Chicago den Krieg. Eindeutig und in Anspielung auf den verrückt-brutalen Oberst Kilgore aus dem Kriegsfilm Apocalypse Now. Friedrich Merz würden wir dafür als irre erklären. Zu recht. Bei Populisten zucken wir die Schultern. Statt ihren Wahnsinn klar zu benennen, verschweigen wir ihn. Dafür machen wir aus einem "Jepp" eine ernste Aussage.
Gefahr für die Demokratie
Tun wir, als handle Trump ernsthaft, verlieren die Menschen das Vertrauen in die Politik. Stört sich niemand daran, wenn auf ständige Großankündigungen nie logisch nachvollziehbare Maßnahmen folgen, glaubt irgendwann niemand mehr an einen Zusammenhang zwischen Worten und Taten.
Politik verkommt zu einer einer Bühne, einer Unterhaltungsform, einer Reality Show. Wir meinen, wir könnten wählen wen wir wollen, am Ende bleibe ohnehin alles weitgehend beim Alten: Die Durchschnittseinkommen steigen weiter wie in den vergangenen Jahrzehnten, die Kriminalität nimmt ab, die Lebenserwartung zu. Das tun sie aber nur, wenn wir unsere Demokratie erhalten.
Vergessen wir, welch harte Folgen Politik auf den Alltag hat, wählen wir den besten Showmaster. Der führt unser Land ähnlich in den Abstieg wie Donald Trump die USA.
Behandeln wir Populisten wie alle Politiker
Wollen wir unsere Demokratie erhalten, müssen Medien und Öffentlichkeit Politiker an ihren Worten messen.
Bei ernsthaften Politikern gelingt uns dies meist. Die Ampelkoalition von Kanzler Olaf Scholz (SPD) und die Schwarz-Rote Koalition von Kanzler Friedrich Merz mussten und müssen sich ständig an gebrochene Versprechen erinnern lassen. Energiesteuern nicht sofort gesenkt? Skandal! Richtig so.
Weil Populisten aber täglich neue Behauptungen in die Welt schleudern, verlieren Medien und Öffentlichkeit offenbar den Überblick oder die Energie, sich an alle zu erinnern. Einige Medien nutzen auch lieber die Klicks, die ihnen große Worte bringen, als die großen Worte einzuordnen.
Dadurch schaffen wir, was wir vermeiden wollen: Weil wir bei ernsthaften Politikern ständig an gebrochene Versprechen erinnern und Populisten ihre viel häufigeren Wortbrüche durchgehen lassen, wirken Populisten wie die glaubwürdigeren Alternativen.
Der Eindruck trügt natürlich: Populisten schneiden ihre Botschaften auf Reichweite zu, nicht auf Inhalt. Deswegen können sie keine positiven Veränderungen schaffen. Sie müssen gutklingenden, aber inhaltslosen Unsinn verbreiten.

Gilt als faul: Sahra Wagenknecht (BSW), hier bei einem ihrer seltenen Wahlkampfauftritte, verpasste in der Legislaturperiode ab 2021 laut Handelsblatt knapp jede vierte Bundestagssitzung. Auch die Mitglieder von Linkspartei und AfD verpasste mit rund zehn Prozent knapp doppelt so viele Sitzungen wie die Mitglieder der Fraktionen von FDP (4,7 Prozent), SPD (5,6 Prozent) und Union (5,9 Prozent). Selbst die im Vergleich zu den anderen ernsthaften Parteien häufig fehlenden Grünen (6,9 Prozent) erschienen deutlich zuverlässiger als AfD, Linke und Wagenknecht. Derartige Faulheit ordnet ein, wie sich diese angeblichen Retter des Landes wirklich einsetzen - wenn Medien es denn erwähnen.
Schluss mit der Angst vor Populisten
Das Versagen Donald Trumps und die desaströsen Leistungen bereits gewählter deutscher Populisten führen die Probleme vor, die Populisten schaffen. Wir müssen sie klar benennen. Sonst lassen wir uns von Populisten immer zum nächsten Thema treiben. Dann gelingt ihnen ihre Vertuschungstaktik.
Schweigen, vorsichtiges Berichten oder faules Nichteinordnen zerstört Glaubwürdigkeit. Medien und Demokraten, die Angst haben, Trump und andere Populisten so zu beschreiben, wie sie sind, sägen am Fundament unseres Wohlstands und unserer Sicherheit.
Uns bleiben zwei Lösungen
- Populisten ignorieren. Das funktioniert nicht. Die Menschen fragen sich dann, warum über einige Politiker nicht berichtet wird und warum diese im Alltag totgeschwiegen werden. Um es ihnen zu erklären, müssten Medien aber über diese Politiker berichten und Menschen über sie reden. Der Ansatz geht nicht auf.
- Trump mutig einordnen. Klar machen, was Trump früher gesagt und nicht umgesetzt hat. Seine Nähe zu Putin benennen. Seine widersprüchlichen Aussagen einordnen. Erklären, warum ein „Jepp“ von Trump nicht das gleiche bedeutet wie eine politische Zusage von Merz oder Scholz. Dieser Ansatz fordert mehr Einsatz, mehr Aufwand. Aber nur so halten wir den Populismus auf.
Gemessen an den Vorteilen, die uns die zweite Option bringt, können wir unsere Zeit kaum sinnvoller einsetzen.
Mehr zum Thema: Wie wir Populismus erkennen und aus der Politik verbannen, erfahren Sie in meinem Buch „Es gewinnen alle oder keiner“.
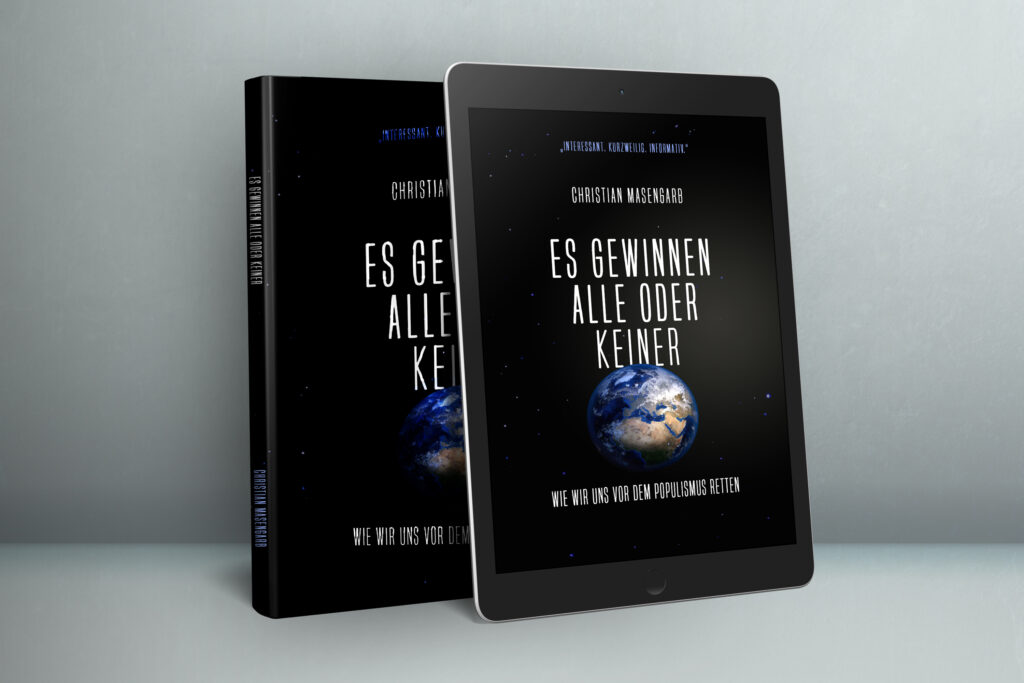
Artikelbild: US-Präsident Donald Trump und der polnische Präsident Karol Nawrocki gehen am Mittwoch, den 3. September 2025, entlang der Westkolonnade ins Oval Office zu einem Treffen.
Quelle: Offizielles Foto des Weißen Hauses von Molly Riley, By The White House – https://www.flickr.com/photos/202101414@N05/54765506583/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=174385349.




